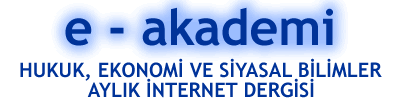|
|||||||||
|
Makale:
Liberalismus versus
Kommunitarismus
„Sozialphilosophische Positionen zu
Multikulturalität und Grundrechten“
Özet:
Liberalizm vs Komünteryenizm
‘Çok kültürlülüğe ve temel haklara ilişkin sosyal-felsefi
pozisyonlar’
Parg. 1.
Komünteryenizm,
günümüzde çok geniş kesimlerce kullanılan bir anahtar sözcük halini
almakta; ancak hem retorikte hem de bu retoriğe dayalı olarak
yürütülen tartışmalarda bu kavramın içeriği hakkında
kesin bir bilgiye pek rastlanmamakta, anlamına ilişkin yoğun sis
halen etkisini sürdürmektedir. 70’li yıllarda John Rawls’ın ‘Theorie
of Justice’ eseriyle başlayan ve 80’li yılların sonunda
sosyalist pratiğin başarısızlığa
uğramasıyla önceleri Amerika Birleşik Devletlerini,
sonraları ise Avrupa’yı etkilemeye başlayan Komünteryenizm anlayışı,
ortak bir değerler sistemini toplumsal yapının temel
referansı olarak almakta, ancak kendi içinde de birbirleriyle
uyuşması zor kanatları barındıran bir yelpaze görünümü
vermektedir. Bu çalışmada John Rawls’ın anlaşılabilmesi
için öncelikle Liberal teoriye kısaca değinilmekte, sonra da
Rawls’ın adalet teorisi ve onunla alevlenen komünteryen karşıt
eleştiriler okuyucuya sunulmaktadır. Alasdair MacIntyre’in “gelenek
ve erdem” anlayışı ile Michael Walzer’in “karmaşık
eşitlik” yaklaşımları bu bağlamda değerlendirilmektedir.
Ancak “liberal” ya da “komünteryen/toplumcu” çatışmasında ve toplumsal
projeler sunumunda, Feminizmin ilgisiz bir tutum benimsemesi beklenemezdi.
Feminist teori, liberal teorinin tarihsel olarak çok kazanımlar sağladığını,
biçimsel- yasal eşitlik konusunu çözdüğünü teslim etmekte, ancak bunun ötesine geçemediğini, yani
birey-devlet ilişkisi ve bunlar arasındaki iktidar dağılımı konusuyla sınırlı
kaldığını, örneğin devletin taraf
olmadığı kurumlarda iktidar paylaşımına değinmediğini,
aile içi iktidar sorunlarını “özel alana” ait olarak nitelendirdiğini,
ayrıca “toplumsal cinsiyet” sorununa ilgi duymadığını
da vurgulamaktadır. Feminizmin komünteryenizme yaklaşımında
ortak noktaların çokluğu dikkati çekmektedir, bunun nedenini de
komünteryenizmin liberalizme olan eleştirisini, Marksizm ve kültürel feminizmin
de kullandığı argümanlara dayandırmasında aramak
gerekir. Ancak komünteryen anlayış içinde “erdem”, “gelenek” ya da “ön
verili yaşam biçimleri” gibi referansların –en azından bir kanadında
– yüceltildiği göz önüne alınırsa, feminizmin komünteryenizme eleştirel
yaklaşmaması beklenemezdi zaten. Ancak feminist teorinin
eleştiri oklarının komünteryenizmin “evrenselci-eşitlikçi”
kanadına yöneltilmiş olanların sayısının oldukça
düşük kaldığını da burada vurgulamak gerekir. (Özet ve
açıklama: Dr. Osman CAN-Editör)
I. Einleitung
Parg. 2. Dieses Referat versucht, die Grundzüge einer sehr umfassenden Diskussion um die Möglichkeit einer gerechten Gesellschaft in verständlicher Weise darzustellen. Dieser Versuch hat zu einer Art Kompromiss zwischen Inhalt und Lesbarkeit geführt: Einerseits wurde die Diskussion auf wenige Punkte reduziert, andererseits musste ich weitgehend auf Beispiele und ausführliche Erläuterungen verzichten.
Parg. 3. Mein Ziel ist eine nachvollziehbare Erläuterung der Grundannahmen und Hauptargumente beider Seiten. Dem wurden viele interessante Nebenaspekte geopfert, insbesondere die Rezeption der Kommunitarismus-Diskussion in Deutschland hätte ich wirklich gerne untersucht:
Parg. 4. Kommunitarismus ist hierzulande zu einem in breiten Kreisen gebrauchten Schlagwort geworden -- Politiker wie Joschka Fischer und Kurt Biedenkopf bekennen sich dazu, Kommunitaristen zu sein -- ohne dass die Bedeutung dieses Wortes irgendwie bestimmt wäre. Anscheinend sind beim Gebrauch dieses Wortes in der Öffentlichkeit höchst unterschiedliche Bedeutungen intendiert, die wohl alles zwischen einer Kritik thatcheristischer Wirtschaftspolitik und der Rückbesinnung auf die Nation beinhalten können.
Parg. 5. Ich hoffe, dass dieses Referat ein Hintergrundwissen vermitteln kann, das auch diese öffentliche Rolle des Kommunitarismus verstehen hilft.
II. Liberalismus
Parg. 6. Für das Verständnis des Liberalismus, wie er in der Kommunitarismus-Debatte erscheint, sind neben Rawls' Ansatz auch allgemeine Grundzüge liberaler Theorie von Bedeutung. Diese Ausgangspunkte liberalen Denkens sollen hier zuerst in ihrer historischen Entwicklung kurz dargestellt werden. Entsprechend der aktuellen Diskussion, die ihre Grundlagen im englischsprachigen Raum findet, genügt auch hier eine Darstellung, die sich schwerpunktmäßig mit den dortigen Entwicklungen befasst.
A. Geschichte
Parg. 7. Die Ursprünge des Liberalismus liegen in der Auflehnung des Bürgertums gegen den Absolutismus[1]. Bedeutender Ausdruck dieser Opposition waren z.B. Lockes ,,Two Treatises on Government“ von 1690[2].
Parg. 8. In dieser Streitschrift lehnt Locke das göttliche Herrschaftsrecht ab, mit dem damals generell die Ausübung politischer Macht gerechtfertigt wurde. Er fordert eine andere Rechtfertigung der Machtausübung. Diese Forderung stützt er auf das Denkmodell eines Naturzustandes, in dem die Menschen vor der Entstehung jeglicher Herrschaftsformen gelebt haben.
Parg. 9. Dieser Zustand ist lt. Locke gekennzeichnet dadurch, dass es keine Herrschaft von Menschen über Menschen gibt, dementsprechend geht die Handlungs- und Verfügungsfreiheit des einzelnen sehr weit, sie ist lediglich durch einige Naturgesetze beschränkt. In der Konsequenz liegen Machtausübung und Rechtsprechung in allen Händen, alle haben den gleichen Rang.
Parg. 10. Eingeschränkt wird die Freiheit des Einzelnen durch Naturgesetze, die den Schutz von Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum gebieten. Diese Gesetze beruhen Locke zufolge einerseits darauf, dass diese Güter von Gott gegeben sind und darum kein Eingriff in diesen göttlichen Willen zulässig ist, andererseits auf der Gleichheit innerhalb der damaligen menschlichen Gemeinschaft, die niemanden zu solchen Eingriffen ermächtigt.
Parg. 11. Übertretungen der o.g. Naturgesetze darf jeder ahnden -- allerdings nur, um den Schaden wiedergutzumachen, abzuschrecken, Reue hervorzurufen und den Übergriff nicht lohnend erscheinen zu lassen.
Parg. 12. Neben dieser Bestrafung im Naturzustand gibt es allerdings noch den Kriegszustand. Dieser tritt ein, wenn ein Mensch einem anderem das Leben oder die Freiheit nehmen will. Durch den Kriegszustand werden das ursprüngliche Opfer und dessen Unterstützer berechtigt, den Angreifer zu töten und ihn zu diesem Zweck so lange zu verfolgen, bis dieser eine ausreichende Wiedergutmachung und Garantien für die Zukunft anbietet.
Parg. 13. Dieser Kriegszustand entsteht schnell, auch aus geringfügigem Anlas, wenn es keine Instanz gibt, die Streitigkeiten schlichtet. Um das zu vermeiden, und um alles in allem sicherer, komfortabler und friedlicher zu leben, haben sich die Menschen zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen.
Parg. 14. Dieser freiwillige Zusammenschluss ist für Locke die einzige Möglichkeit, wie sich die Menschen, die von Natur aus frei, gleich und unabhängig sind, rechtmäßig in die ,,Fesseln der bürgerlichen Gesellschaft“[3] begeben können. Mit dem Zusammenschluss geben die einzelnen ihre Kraft und ihre Verteidigungsrechte an die Gesellschaft ab, soweit dies notwendig ist, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Die politische Macht leitet sich also aus den einzelnen Bürgern ab.
Parg. 15. Über die Verwendung der Macht wird mit Mehrheitsbeschluss entschieden, das begründet Locke mit dem Bild eines Körpers, der sich dahin bewegt, wohin ihn die stärkste Kraft treibt. Da der Zusammenschluss zu einem bestimmten Zweck geschieht, kann die (durch den Zusammenschluss entstandene) Gesellschaft auch nur in bestimmten Bereichen aktiv werden, namentlich: um Gesetze zur Erhaltung von Leben, Freiheit und Vermögen zu schaffen, um nach diesen Gesetzen unparteiisch Recht zu sprechen und um die Vollstreckung dieser Urteile zu gewährleisten.
Parg. 16. Locke betont, dass die Gesellschaft nur die o.g. Aufgaben wahrnehmen darf, die der ursprünglichen Übereinkunft entsprechen, und dass dementsprechend nur Frieden, Sicherheit und das öffentliche Wohl legitime Ziele der Machtausübung sein können. An diesen Bindungen kann für ihn auch nichts ändern, wenn die Machtausübung z.B. auf eine Erbmonarchie übertragen wird
Parg. 17. Ähnlich wie Locke dachten in der Folgezeit viele: Der Staat sollte sich auf den Schutz der Grundrechte seiner Bürger beschränken. Als Gegenentwurf zur bisherigen absoluten Herrschaft von Adel und Königen wurde das Bild eines Nachtwächterstaats hochgehalten, in dem auf einem selbst-regulierenden Markt das Gute für die Gesellschaft dadurch entsteht, dass die einzelnen Bürger nach dem für sie besten streben[4] - von den radikalsten Vertretern dieser Idee wurde dem Staat sogar die Zuständigkeit für Straßenbau und -erhaltung abgesprochen[5].
Parg. 18. Vertreter derartiger Ideen gehörten in den folgenden Jahren und Jahrhunderten zu den Mitverursachern großer Veränderungen. Es kam zur Abschaffung adliger Privilegien, ein Umbau hin zu kapitalistischen Gesellschaftsformen fand statt. Die Mittelklasse konnte daraufhin erstmals ihre Kräfte voll nutzen, das führte zu einer Ausweitung der Produktion und zur Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums. Mit der Zeit wurden repräsentative und konstitutive Regierungsformen aufgebaut, und nicht zuletzt wurde die Idee der allgemeinen Grundrechte weiter verbreitet und entwickelt[6].
Parg. 19. Ungefähr zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts begannen liberale Theoretiker allerdings, Probleme in der Konzeption des klassischen Liberalismus zu sehen. Kritisiert wurde zum Beispiel, dass die Markt-Macht zu ungleich verteilt war, insbesondere zu ungunsten von Arbeitsuchenden, die oft keine besondere Wahlfreiheit hatten. Auch die Verbraucher beherrschten nicht den Markt, wie es den Theorien entsprochen hätte.
Parg. 20. Dazu kam, dass der freie Wettbewerb nicht so funktionierte, wie es sich die ersten Theoretiker vorgestellt hatten: Es kam zu Kapitalkonzentrationen. Einerseits führte dies dazu, dass große Teile der Bevölkerung am Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums kaum beteiligt waren, andererseits schadeten die Konzentrationen der allgemeinen Kaufkraft-Entwicklung. D.h.: denjenigen, die die Konsumgüter der expandierenden Industrie hätten abnehmen können, fehlte eben auf Grund der Konzentrationen die notwendige Kaufkraft. Mangels eines entsprechenden Marktwachstums konnten also die Produktionspotentiale nicht ausgeschöpft werden, in der Folge kam es zu Stagnationsperioden, den sogenannten Depressionen.
Parg. 21. Den Idealen der ersten Liberalen entsprach ebenfalls nicht, dass sich wirtschaftliche und oft auch politische Macht in den Händen derer konzentrierten, die die Produktionsmittel besaßen. Insgesamt führte diese Beurteilung dazu, dass auch Liberale nunmehr für staatliche Korrekturen der Wirtschaft und für eine ausdrückliche Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Interessen der Bevölkerung in der Politik eintraten.
Parg. 22. Ziele waren nunmehr auch das Eingehen auf die Bedürfnisse Benachteiligter und das Eindämmen von Ressourcen-Verschwendung zugunsten einer Berücksichtigung allgemeiner Grundbedürfnisse. Als Mittel zur Durchsetzung dieser Ziele sah man einerseits die Unterstützung der Marktmacht von Arbeitern und Konsumenten, z.B. durch die Förderung von Gewerkschaften, andererseits politische Hilfsmaßnahmen für die Benachteiligten, die der Idee eines Wohlfahrtsstaates entsprachen. Dazu kamen in den dreißiger Jahren die Ideen John Maynard Keynes[7], denen zufolge der Staat in Rezessionszeiten seine Ausgaben erhöhen sollte, um so die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Staat sollte, so fasst Girvetz zusammen, aktiv für eine gerechtere Verteilung und eine expandierende Wirtschaft eintreten[8].
Parg. 23. Seit den 60er Jahren wurde diese Entwicklung verstärkt angegriffen, der neoliberale Ökonom Milton Friedman bemerkte z.B., dass die Liberalen des zwanzigsten Jahrhunderts primär nach Gleichheit und allgemeiner Wohlfahrt strebten und dafür Zentralismus, Staatsinterventionen und Paternalismus in Kauf nähmen. Der Begriff des Liberalismus sei dadurch korrumpiert[9].
Parg. 24. Dem setzt Friedman das Bild eines ,,wirklich liberalen Staates“ entgegen, der hauptsächlich die Aufgaben wahrnimmt, die ihm auch Locke schon zugewiesen hat - zum Schutz der Freiheit nach innen und außen kommen hier lediglich gewisse, eng umrissene Unterstützungs-Funktionen zugunsten derjenigen, die nicht selbstverantwortlich handeln können. Friedman denkt hier v.a. an die Unterstützung der Familie bei der Pflege geistig Behinderter und in Ausnahmefällen auch bei der Sorge für Kinder. Eigentlich neu erscheint an seinen Vorschlägen, dass er auf die Probleme, die sich aus Monopol-Bildungen ergeben, eingeht, und in derartigen Situationen staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zum Schutze der wirtschaftlichen Freiheit befürwortet.
B. Rawls' Theorie der Gerechtigkeit
1. Die Voraussetzungen
Parg. 25. Eine besondere Rolle in der neu aufflammenden Diskussion um die Grundlagen einer liberalen Gesellschaft spielte dann die ‚Theory of Justice’, die Rawls 1971 veröffentlichte[10]. An diesem Buch entzündete sich eine breite Diskussion, die schließlich auch zur Formierung des gegenwärtigen Kommunitarismus führte.
Parg. 26. In seinem Buch legt Rawls die theoretische Grundlage für eine liberale Demokratie, in der auch soziale Belange öffentlich berücksichtigt werden. Bestehende Ansätze aus Soziologie und Wirtschaftswissenschaften werden zu einer neuen, umfassenderen Theorie zusammengeführt und weiterentwickelt[11].
Parg. 27. Rawls geht davon aus, dass Gerechtigkeit die wichtigste Tugend sozialer Institutionen ist[12]. In seinen weiteren Ausführungen geht er allerdings nicht direkt auf die Frage zu, welcher der verschiedenen theoretischen Ansätze in der Diskussion um die gerechte Gesellschaft vorzuziehen ist. Stattdessen greift er in der Tradition von Locke zum Mittel des Gesellschaftsvertrages: Rawls stellt die Frage, welches soziopolitische Arrangement wir wählen würden, wenn wir uns frei und ohne Parteilichkeiten entscheiden könnten.
Parg. 28. Als Voraussetzung für eine wirklich unbeeinflusste Entscheidung entwirft Rawls das Szenario einer Versammlung, in der die einzelnen durch einen ,,Schleier des Nichtwissens“[13] von ihren Eigeninteressen getrennt werden. Genauer: Niemand weiß um seinen sozialen Status, um seine körperlichen und geistigen Gaben, um seine Lebensziele und -einstellungen oder auch um den genaueren Charakter der derzeitigen Gesellschaftsform. Demgegenüber haben alle Mitglieder der Versammlung ein gleiches Grundwissen, das die generellen Prinzipien von Wirtschaft, sozialer Organisation, Psychologie und Politik beinhaltet.
Parg. 29. Durch diese Vorkehrungen will Rawls erreichen, dass die Gesellschaftsform, die unter diesen Bedingungen gewählt werden würde, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gerechte Gesellschaft ist. Vor allem stützt sich diese Hoffnung darauf, dass die Partikularinteressen der Entscheidenden keine Berücksichtigung finden können, so dass nur nach generellen Erwägungen entschieden wird. Die Ausführbarkeit des resultierenden Gesellschaftsentwurfes wird durch das Grundwissen der Entscheidenden wahrscheinlich.
Parg. 30. Zu den Entscheidungsträgern ist prinzipiell nur zu sagen, dass es sich um Einzelpersonen handelt, die unter Berücksichtigung von folgenden Generationen ihrer Familie rational und ohne Neid entscheiden. Allerdings vereinfacht Rawls die Entscheidungsfindung erheblich, indem er folgende Überlegung zum Tragen bringt: Wenn jeder das gleiche, lediglich allgemeine Wissen hat, und wenn alle sich gleich rational verhalten, dann werden alle gleich entscheiden. Darum reicht es, die Wahl einer zufällig ausgewählten Person zu betrachten.
Parg. 31. Dieser Kunstgriff verringert die Schwierigkeit, das Arrangement zu finden, das unter diesen Bedingungen gewählt werden würde, erheblich: Nunmehr kann jeder sich selbst als die einzig relevante wählende Person betrachten, sofern er sich den Schleier des Nichtwissens auferlegt.
Parg. 32. Gegenstand der Entscheidung sind die sozialen Institutionen und ihr Zusammenwirken, die Rechte und Pflichten des einzelnen und die Verteilung des gemeinsam Erwirtschafteten, insgesamt also die Grundstrukturen der Gesellschaft. Zwingend vorgeschrieben ist die Form, in der diese Grundstrukturen festzulegen sind: Als erster Schritt zu einer gerechten Gesellschaft sind öffentlich anerkannte oberste Prinzipien festzulegen, die immer und für alle gelten. Rawls bezeichnet dies als eine öffentlich anerkannte Gerechtigkeitskonzeption. Vorgegeben wird damit ein Rechtsstaat als nicht-dispositive Grundstruktur[14].
Parg. 33. Weitere Vorgaben zur Entscheidungsfindung sind einige Annahmen über die Gesellschaftsmitglieder und die Rahmenbedingungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerung mit der gewählten Gerechtigkeitskonzeption größtenteils konform geht und sich hauptsächlich für die eigenen Belange interessiert. Die Gesellschaft befindet sich nach Rawls' Annahmen weiter in einer Situation mit moderater Knappheit der Güter bei widerstreitenden Forderungen der einzelnen, so dass Verteilungsprobleme zu lösen sind.
Parg. 34. Unter Berücksichtigung all dieser Vorgaben ist dann die Entscheidung für eine Gerechtigkeitskonzeption zu treffen. Um dies handhabbar zu gestalten, schränkt Rawls die potentiell unendlich vielen Alternativen auf eine Liste üblicher Möglichkeiten ein[15]. Auf dieser Liste befinden sich:
- Rawls Konzeption, die noch näher zu erklären sein wird.
- Die Gruppe der klassischen teleologischen Konzeptionen, zu denen u.a. der Utilitarismus gehört. Die Gesellschaft soll nach diesen Theorien auf das Erreichen eines Zieles ausgerichtet sein, beim Utilitarismus ist z.B. dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen alles andere unterzuordnen.
- Eine Gruppe ,,gemischter“ Konzeptionen, die verschiedene utilitaristische Gedanken mit Elementen zum Schutz der Freiheit verbinden.
- Intuitionistische Konzeptionen, die z.B. auf der Abwägung einer Liste von auf den ersten Blick einleuchtenden Grundsätzen beruhen.
- Egoistische Ideen wie die, dass jeder meinen Interessen dienen muss.
Parg. 35. Daraufhin diskutiert Rawls die Strategien, die zur systematischen Auswahl unter diesen Möglichkeiten dienen können[16]. Als Alternativen stehen hier zur Auswahl:
- Die Maximin-Strategie, die zur Auswahl der Alternative führt, die im schlechtesten Fall das für den Entscheidenden beste Ergebnis bringt.
- Die Maximax-Strategie, nach der die Alternative zu wählen ist, die im besten Fall zum besten Ergebnis führt.
- Die Nutzenmaximierungs-Strategie, bei der alle möglichen Resultate einer Alternative jeweils mit ihrer Wahrscheinlichkeit gewichtet werden und die Summe den Ausschlag gibt.
Parg. 36. Gegen die Maximax-Strategie spricht ihre Riskantheit: Ein Mitglied der Versammlung könnte sich ihr zufolge z.B. für eine absolute Monarchie entscheiden, da es dann im besten Fall absolutistischer Herrscher werden könnte. Dabei würde allerdings nicht berücksichtigt, dass es im Absolutismus nur eine einzige derartige Position zu besetzen gilt, während alle anderen sehr viel schlechter abschneiden.
Parg. 37. Gegen die Nutzenmaximierungs-Strategie spricht lt. Rawls, dass die Wahrscheinlichkeiten und die Bewertungen der Resultate wohl kaum exakt zu ermitteln sind. Dazu kommt die Überlegung, dass so wichtige Entscheidungen wohl eher konservativ getroffen werden, und dass schlechte mögliche Ergebnisse die Entscheidenden abschrecken werden. Bei letzterem ist z.B. an eine Gesellschaftsform zu denken, in der es der Mehrheit sehr gut, einer kleinen Unterschicht jedoch sehr schlecht geht -- die Summe aller Nutzen könnte hier durchaus höher sein als bei einer Gesellschaft, in der es allen halbwegs gut geht, trotzdem wird die Aussicht, sich eventuell in dieser Unterschicht wiederzufinden, die Entscheidenden hier zurückhalten.
Parg. 38. Übrig bleibt demnach die Maximin-Strategie. Rawls zufolge werden bei Anwendung dieser Strategie voraussichtlich die folgenden zwei Prinzipien als öffentlich anerkannte Gerechtigkeitskonzeption ausgewählt[17]:
1. Jede Person hat ein gleiches Recht auf ein völlig adäquates System gleicher Grundrechte und Grundfreiheiten, das mit dem gleichen System für alle anderen vereinbar ist.
2. Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offen stehen, und zweitens müssen sie zum größten Vorteil der am wenigsten begünstigten Mitglieder einer Gesellschaft sein.
Parg. 39. Von diesen Prinzipien, die Rawls' Vorschlag darstellen, hat das erste den Vorrang vor dem zweiten, und innerhalb des zweiten hat die Chancengleichheit Vorrang vor dem zweiten Teil, dem sog. Differenzprinzip. Außerdem hat Gerechtigkeit Vorrang vor Effizienz und Wohlfahrt. Zusammenfassen lassen sich die Prinzipien damit so[18]:
Parg. 40. Alle Primärgüter der Gesellschaft - Freiheit und Möglichkeiten, Einkommen und Reichtum, und die Grundlagen der Selbstachtung - sollen gleich verteilt sein, wenn nicht eine ungleiche Verteilung eines oder aller dieser Güter zum Vorteil der Benachteiligten ist.
Parg. 41. Die Auswahl dieser Prinzipien nach der Maximin-Strategie wird von Rawls damit begründet, dass das zweite Prinzip für das Wohlergehen der Benachteiligten sorgt und das erste auch ihnen die Freiheit erhält[19].
Parg. 42. Dazu kommen Machbarkeitsüberlegungen: Rawls argumentiert, dass diese Prinzipien verlässlich eingehalten werden, da sie für niemanden untragbar sind, dass sie vielmehr unterstützt werden, da sie zum Guten für jeden einzelnen beitragen. Dazu kommt, dass diese Prinzipien jedem die Selbstachtung garantieren, auch dies verbessert die soziale Kooperation[20].
Parg. 43. Weiter stellt Rawls sein Konzept als intuitiv naheliegend dar: Eine gleiche Verteilung aller gesellschaftlichen Güter ist der intuitive Ausgangspunkt - warum sollte man sich mit weniger zufrieden geben, und mehr ist nicht sicher. Von dieser Regel kann man allerdings dann Ausnahmen zulassen, wenn sie im Endeffekt zum Vorteil aller sind. Ob das der Fall ist, lässt sich am Fall der Benachteiligten feststellen[21].
Parg. 44. Nach der Festlegung der Grundprinzipien wird der Schleier des Nichtwissens teilweise gelüftet. Generelle Fakten wie z.B. die ökonomischen Grundlagen und die politische Kultur werden bekanntgegeben, mit diesem Wissen wird eine Verfassung entworfen[22].
Parg. 45. Dann wird wiederum mehr bekannt, es werden Gesetze geschaffen, und schließlich wird der Schleier vollständig gehoben und das Leben bzw. die Gesetzesanwendung in der neuen Gesellschaft beginnt.
2.
Folgerungen aus den Prinzipien
Parg. 46. Als Beispiel für eine mögliche Verfassung nennt Rawls die liberale Demokratie. Er führt aus, dies sei lediglich ein Beispiel, auch andere Gesellschaftsformen seien mit seinen Prinzipien vereinbar[23]. Allerdings leitet er im folgenden aus seinen Prinzipien eine Reihe von Anforderungen an die Verfassung ab, die diese Offenheit schwer vorstellbar erscheinen lassen.
Parg. 47. Folgendes sind Rawls Anforderungen:
- Der Staat muss als ein Zusammenschluss gleicher Bürger agieren[24].
- Es darf keine offizielle Philosophie oder Religion geben, dem einzelnen muss ein Rahmen für den individuellen Umgang mit diesen Themen gewährleistet sein. Dieser Rahmen muss eigenen Prinzipien entsprechen, auf die sich die Gesellschaftsmitglieder unter dem Schleier des Nichtwissens geeinigt hätten[25].
- Die Freiheit darf nur beschränkt werden, um Ordnung und Sicherheit dem gemeinsamen Interesse entsprechend zu wahren. Auch hier sind Grundsätze zu befolgen, wie sie auch unter dem Schleier des Nichtwissens beschlossen worden wären[26].
- Freiheit darf nur zugunsten von Freiheit eingeschränkt werden. Gewissensfreiheit muss allen in gleichem Maße gewährt werden, und wenn die Verfassung gesichert ist, gibt es keinen Grund, nicht auch den Intoleranten Freiheit zu gewähren[27].
Parg. 48. Alles in allem soll die Verfassung eine gerechte Prozedur bereitstellen, die den Anforderungen gleicher Freiheit genügt, und durch die gerechte und effektive Gesetzgebung wahrscheinlich wird. Durch die Forderung nach gleicher Freiheit werden Partizipationsmöglichkeiten für alle gefordert, im Endeffekt also eine Demokratie[28].
Parg. 49. Die Freiheit erfordert auch Beschränkungen der Legislativmacht, z.B. durch ein Zweikammer-System, Gewaltenteilung, ,,checks and balances“ und einen richterlich überwachten Grundrechtskatalog. Außerdem ist auch für die Durchsetzung der Freiheit ein Rechtsstaat erforderlich, damit die Grenzen der Freiheit klar sind und voll ausgeschöpft werden können. Auch ist die Macht der Exekutive soweit wie möglich zu beschränken, aber gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass ihr genug Macht verbleibt, um die Gesetze durchsetzen zu können.
Parg. 50. Im Bereich der Wirtschaftsordnung ist für Rawls vor allem das zweite seiner Prinzipien wichtig[29], also einerseits die Chancengleichheit, andererseits das Differenzprinzip, d.h. das Prinzip, demzufolge soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zum größten Vorteil der Benachteiligten sein müssen. Dabei hat die Chancengleichheit den Vorrang.
Parg. 51. Chancengleichheit ist lt. Rawls in der Wirtschaft zu erreichen durch Kontrolle des Verhaltens der Unternehmen, durch Vorbeuge vor Monopolen und durch die Garantie eines Mindesteinkommens. Die Verhaltenskontrolle soll dazu dienen, um:
- Im Preissystem einen angemessenen Wettbewerb zu erhalten und die Bildung von übermäßiger wirtschaftlicher Macht zu verhindern -- Abwägungsgrundlage sind hier die Pareto-Optimalität[30], geographische Tatsachen und die Wünsche der Haushalte. Den hierfür zuständigen Bereich des Staates nennt Rawls die ,,Allokationsabteilung“[31].
- Vollbeschäftigung der Arbeitswilligen, freie Berufswahl und adäquate Verdienstmöglichkeiten zu gewährleisten und um die Effizienz der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Hierfür zuständig ist lt. Rawls die ,,Stabilisierungsabteilung“ des Staates[32].
- Soziale Mindeststandards wie z.B. ein Existenzminimum für alle zu garantieren. Dies wird von der ,,Umverteilungsabteilung“ geleistet[33].
- Durch Besteuerung und eventuell auch durch Anpassung der Eigentumsrechte die Verteilung ungefähr gerecht zu gestalten. Zu denken ist hier z.B. an Schenkungs- und Erbschaftssteuern, die eine Streuung des Eigentums begünstigen, oder an allgemeine Steuern, durch die der Staat die Mittel z.B. für die Sicherung des Existenzminimums erhält. Dies fällt in den Bereich der ,,Verteilungsabteilung“[34].
Parg. 52. Weiter führt Rawls aus, dass all diese Anforderungen Ideale sind, so dass der Gesellschaftsvertrag auch dann bindet, wenn sie nicht voll erreicht werden. Wenn allerdings die Freiheit wiederholt verletzt wird und auch der gerichtliche Rechtsschutz nicht greift, dann ist ziviler Ungehorsam und in Extremfällen auch Rebellion gerechtfertigt.
III. Auseinandersetzungen um Rawls' Gerechtigkeitstheorie
Parg. 53. In den Diskussionen zu Rawls' Theorie sind verschiedene Kritik-Ansätze herausgearbeitet worden. Von den Neoliberalen und ,,libertarians“ wird Rawls z.B. vorgeworfen, er berücksichtige nicht hinreichend, dass durch Umverteilung schwerwiegende Eingriffe in die wohlerworbenen Rechte der Eigentümer geschähen -- Rawls würde die Dinge wie vom Himmel gefallenes Manna behandeln. Dazu kommt der praktische Vorwurf, dass der Staat immer wieder in das Leben der Bürger eingreifen müsse, um das von Rawls postulierte Ideal dauerhaft verfolgen zu können[35].
Parg. 54. Die prominenteste Kritik an Rawls' Form des Liberalismus kommt allerdings von einer anderen Seite. Verschiedenste Autoren teilen die Grundüberzeugung, dass abstrakte moralische Prinzipien, wie Rawls sie sucht, losgelöst von allen konkreten Gegebenheiten, nicht sinnvoll sein können. Unter den Oberbegriff ,,Kommunitarismus“ werden unterschiedliche Ansätze gefasst, deren Gemeinsamkeit es ist, dass sie alle das Ideal des unparteiischen, wertpluralistischen, quasi anonymen Staates anzweifeln und dem die Rückbesinnung auf eine Gemeinschaft mit gemeinsamem Werte-Horizont entgegensetzen[36].
A. Sandels kommunitaristische Kritik
Parg. 55. Die wohl detaillierteste Kritik an Rawls' Entwurf stammt von Michael Sandel. Dessen Analyse setzt v.a. am Persönlichkeitsbegriff an, der eine der Grundlagen der ,,Theorie der Gerechtigkeit“ ist.
Parg. 56. Sandel arbeitet heraus, dass Rawls' Idee eines ,,Schleier des Nichtwissens“ bei dem Einzelnen ein sog. ,,ungebundenes Selbst“ erfordert[37]. Damit ist gemeint, dass das Selbst des Einzelnen unabhängig von dessen Zielen sein muss: Wenn ein Mensch auch hinter dem ,,Schleier“ noch wählen kann, obwohl seine individuellen Ziele durch den ,,Schleier“ ausgeblendet sind, dann bedeutet dies, dass das eigentlich entscheidende Wesen des jeweiligen Menschen, das Selbst, nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den jeweils verfolgten Zielen steht.
Parg. 57. Diese Distanz zwischen dem Selbst und den Zielen bedeutet, dass das Selbst derart festliegt, dass es sich auch durch Erfahrungen nicht ändern kann. Das heißt, dass keine Absicht, Rolle oder Verpflichtung so bedeutend sein kann, dass sie oder ihre Abwesenheit die Person an sich in Frage stellten würde.
Parg. 58. Alles in allem machen nicht die Ziele die Person aus -- das wichtige ist die Fähigkeit, die Ziele auszuwählen. Daraus folgt, dass der Einzelne stets in einer gewissen Distanz zu seinen Lebensumständen steht und z.B. nie ganz in einer Gemeinschaft mit festgelegten Werten aufgehen kann.
Parg. 59. Dem Einzelnen steht es frei, seine Ziele und Zwecke ohne Rücksicht auf eine gegebene Ordnung, auf Traditionen oder seinen Status auszuwählen. Seine Auswahl ist das einzige, auf das es ankommt, solange er sich in dem Rahmen bewegt, den ihm die Gerechtigkeitsgrundsätze bieten.
Parg. 60. Nachdem Sandel dieses Persönlichkeitsbild herausgearbeitet hat, setzt er mit seiner Kritik am Differenzprinzip an, das als (letztrangiger) Bestandteil von Rawls' Gerechtigkeitskonzeption besagt, dass ,,soziale und ökonomische Ungleichheiten [...] zum größten Vorteil der am wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft sein [müssen]“[38].
Parg. 61. Rawls' inhaltliche Rechtfertigung dieses Prinzips fasst Sandel so zusammen[39]: Die Verteilung von Talenten oder persönlichen Vorteilen wie Kraft oder Intelligenz findet vom moralischen Standpunkt gesehen willkürlich statt. Genau wie die Talente und Begabungen sind auch die Vorteile, die der Einzelne aus diesen zieht, nicht verdient. Deshalb sind die Talente Allgemeinbesitz, und die gesamte Gesellschaft sollte Nutznießer dieser Gaben sein.
Parg. 62. Diese Begründung führt Sandel wieder auf den von Rawls postulierten Unterschied zwischen Personen und deren Eigenschaften zurück. Daraufhin stellt er infrage, ob daraus, dass der Einzelne moralisch gesehen kein Recht auf derartige Vorteile hat, zwingend folgt, dass die Gesellschaft mehr Rechte an den Begabungen des Einzelnen und ihren Vorteilen hat. Schließlich ist die Zugehörigkeit zu solch einer Gesellschaft genauso zufällig wie der Besitz von Talenten.
Parg. 63. Als Rechtfertigung für einen Anspruch, wie ihn das Differenzprinzip aufstellt, ist eine weitgehende moralische Bindung derjenigen erforderlich, deren Vorteile für das Gemeinwohl eingesetzt werden sollen. Woher, fragt Sandel, soll diese moralische Bindung in einer Gesellschaft kommen, die lediglich auf der Kooperation Freier und Gleicher beruht?
Parg. 64. Wenn die Nutznießer der Vorteile wirklich nur andere sind, Vertragspartner, dann ist eine derartige Berufung auf das Allgemeinwohl nur ein Eingriff in die Freiheit des ursprünglich Bevorteilten. Erforderlich ist vielmehr, dass die Nutznießer Mitglieder in einer Gemeinschaft sind, die auch die Identität des Leistenden prägt, dass ihr Verhältnis auf tiefgreifenden Bindungen an eine Gemeinschaft zurückzuführen ist.
Parg. 65. Das Differenzprinzip erfordert also gemeinschaftliche, moralische Verpflichtungen, die tief in der Persönlichkeit des einzelnen wurzeln. Damit ist entweder die hinter Rawls' Theorie stehende These vom ungebundenen Selbst zutreffend, das keine derartigen tiefen Bindungen kennt, oder das Differenzprinzip, das lt. Sandel nur mit eben diesen Bindungen zu rechtfertigen ist. Diese Entscheidung spitzt sich auf die Frage zu, ob es die von Sandel angeführten, tiefgreifenden Bindungen an Gemeinschaft, Nation, Volk, Vaterland, Republik oder gemeinsame Geschichte tatsächlich gibt. Sandel bejaht dies.
Parg. 66. Einen weiteren Ansatzpunkt für seine Kritik findet Sandel wieder am Persönlichkeitsbild[40]: Er stellt die Frage, wie der Einzelne im Normalzustand, also ohne den ,,Schleier des Nichtwissens“, seine Ziele, Werte etc. auswählen kann. Laut Rawls erfolgt dies orientiert an den Zielen, die bereits vorhanden sind[41]. Für Sandel folgt daraus, dass die Wahl vorrangig aus einer Bestandsaufnahme der bereits vorhandenen Ziele und Wünsche besteht, auf die dann die rationale Feststellung der Möglichkeit folgt, die diesen Zielen am nächsten kommt. Für eine Ausübung des freien Willens bleibt demnach kein Platz, so dass man hier kaum von einer wirklichen Entscheidung oder Wahl sprechen kann.
B. Rawls Reaktion auf diese Kritik
Parg. 67. Rawls geht auf die Argumente von Sandel ein, indem er den politischen Charakter seiner Konzeption unterstreicht[42]. Bei der Theorie der Gerechtigkeit ist das Ziel demzufolge nicht eine metaphysisch begründete, allgemeine Morallehre, sondern ein Gerechtigkeitskonzept für den modernen Verfassungsstaat. Immer wieder wird betont, dass es nicht um die Anwendung einer allgemeinen moralischen Konzeption geht, sondern dass hier eine Theorie weitgehend auf die Bedingungen großer industrieller Marktwirtschaften zugeschnitten wurde, in denen es viele verschiedene Weltanschauungen und Konzeptionen des Guten gibt.
Parg. 68. Diese spezielle, auf die Frage gesellschaftlicher Strukturen beschränkte Moraltheorie baut auf den Ausgangspunkten auf, die alle als gemeinsame Grundlage akzeptieren können. Dies können keine metaphysischen Lehren über das Wesen des Selbst sein. Differenzen über derartige Punkte müssen vielmehr zugunsten der sozialen Kooperation umgangen werden.
Parg. 69. Möglicher Ausgangspunkt sind also lediglich die Grundannahmen, die alle Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft gemeinsam haben. In der demokratischen Tradition gehört dazu, dass alle Menschen freie und gleiche Personen sind. Aus diesen Annahmen folgt weiter, dass alle Menschen einen Gerechtigkeitssinn besitzen und auch alle die Fähigkeit haben, sich eine eigene Konzeption des Guten, also eine Wertordnung, zu bilden.
Parg. 70. Diese Gedanken sind implizit in der öffentlichen Kultur einer demokratischen Gesellschaft enthalten. Das Gesamtbild, das aus diesen Grundannahmen entsteht, ist der politische Personenbegriff, der den Umgang der Gesellschaft mit dem einzelnen Bürger regelt.
Parg. 71. Diesem Personenbegriff steht es nicht entgegen, wenn die ,,nicht-öffentliche Identität“ des einzelnen vollkommen anders ist. Überzeugungen, emotionale Bindungen und Loyalitäten können den Rahmen der Lebensweise einer Person fest vorgeben -- eine derartige Einrichtung der persönlichen Wertordnung hat aber keine Auswirkungen darauf, wie die Gesellschaft mit dem Bürger umgeht: Wenn Saulus zum Paulus wird, bleibt er dabei als politische Person der gleiche.
Parg. 72. Auf Sandels Kritik an der Rechtfertigung des Differenzprinzips geht Rawls wie folgt ein: Gesellschaftliche Einheit und Loyalität muss nicht aus allgemeiner Zustimmung zu einer Konzeption des Guten entstehen. In Rawls' Konzeption bildet sich derartiger Zusammenhalt durch die breite öffentliche Zustimmung zu einer politischen Gerechtigkeitskonzeption, durch einen diesbezüglichen, stabilen, übergreifenden Konsens aller einzelnen Gruppierungen.
Parg. 73. Wenn eine Gesellschaft den Gerechtigkeitsgrundsätzen entspricht, dann stellt sie eine soziale Gemeinschaft der sozialen Gemeinschaften dar. Gemeinsames Gut dieser Meta-Gemeinschaft sind die Gerechtigkeitsgrundsätze, ihre Anwendung ist das gemeinsame Ziel[43].
Parg. 74. Auch wenn es nicht zum o.g. Idealfall kommt, in dem die Gerechtigkeitsgrundsätze verwirklicht, bekannt und verwurzelt sind: Zumindest soziale Kooperation auf der Grundlage gegenseitiger Achtung kann in einem Rahmen entstehen, in dem verschiedene Konzeptionen des Guten nebeneinander existieren[44].
IV. Kommunitaristische Gegenentwürfe
Parg. 75. Während die detaillierte Kritik des Rawls'schen Entwurfes eher selten ist, gibt es eine große Anzahl kommunitaristischer Gegenentwürfe. Diese Theorien kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen: Während die meisten, wie auch Walzer (1993) feststellt, aus der Denktradition des US-amerikanischen Republikanismus stammen, ist der Ansatz von Walzer selbst z.B. sehr viel egalitärer[45], und in der Debatte spielt z.B. auch Jürgen Habermas eine größere Rolle, der von der Frankfurter Schule der kritischen Philosophie und Soziologie kommt[46].
Parg. 76. Um der Vielfalt kommunitaristischer Positionen zu entsprechen, wird im Folgenden zuerst die Position von Alasdair MacIntyre dargestellt. MacIntyre ist ein profilierter Vertreter des republikanischen Ansatzes, er beruft sich insbesondere auf Aristoteles[47]. Darauf folgt der Entwurf von Michael Walzer, der, wie schon oben bemerkt, egalitärer und auch pluralistischer argumentiert, und der dazu den Liberalismus nicht derart fundamental kritisiert wie MacIntyre.
A. Tradition und Tugend: Alasdair MacIntyre
Parg. 77. Für MacIntyre ist moralisches Handeln im allgemeinen nur innerhalb einer Gemeinschaft möglich. Diese bildet den Bezugsrahmen, in dem die moralischen Güter existieren, und bekräftigt den Einzelnen darin, moralisch zu handeln[48].
Parg. 78. Moralisches Handeln lässt sich erreichen, indem man nach dem moralisch Guten für sich und die Gemeinschaft fragt. Wenn diese Frage systematisch gestellt und zu beantworten versucht wird, wenn der Mensch somit sein Leben auf der Suche nach dem guten, d.h. moralischen Leben verbringt, dann lebt er ein moralisches, gutes Leben. Dieses Leben versteht MacIntyre als eine Suche[49] im mittelalterlichen Sinne, deren Ziel erst in ihrem Verlauf klar wird.
Parg. 79. Die Suche des einzelnen nach dem Guten findet in einem Kontext statt, der allgemein durch die Tradition definiert ist. Die konkrete Form des so bestimmten Lebens hängt dabei von dem moralischen Ausgangspunkt des einzelnen ab. Dieser Ausgangspunkt wird durch die Vergangenheit der Familie, der Stadt, des Stammes und der Nation bestimmt, und durch die Schulden, Erbschaften, Erwartungen und Verpflichtungen, die aus dieser Vergangenheit erwachsen. Daraus folgt, dass das, was für mich gut ist, für jemanden gut sein muss, der meinen Ausgangspunkt hatte.
Parg. 80. Die Traditionen spielen in der Gemeinschaft eine tragende Rolle, sie institutionalisieren die Suche nach dem Guten, halten die Suche durch die Generationen aufrecht und fördern die Auseinandersetzung über das Wesen des Guten. Diejenigen Charakterzüge, die die Menschen bei der Suche nach dem Guten unterstützen, und die, die die Traditionen aufrechterhalten, bezeichnet MacIntyre als Tugenden[50].
Parg. 81. MacIntyre sieht in diesem Sinne auch den Patriotismus als eine Tugend an. Moral rechtfertigt sich für ihn aus der Gemeinschaft und deren Erhaltung, gleichzeitig wird die Moral durch die Gemeinschaft erhalten und gefestigt. Da somit kein moralisches Handeln ohne Gemeinschaft möglich ist, ist die Loyalität zur Gemeinschaft eine zentrale Tugend. Eine derartige Loyalität ist auch der Patriotismus[51].
Parg. 82. Für die menschlichen Beziehungen gebraucht MacIntyre Geschichten als Metapher: Das Leben des einzelnen ist eine Geschichte, in der dieser Mensch die Hauptperson ist. Dabei hat er schon mit seiner Geburt eine oder mehrere vorgegebene Rollen, die er aus den Überlieferungen der Gemeinschaft verstehen lernt. In diesen Rollen taucht der einzelne in den Geschichten der anderen Menschen auf. Zu Geschichten werden die aufeinanderfolgenden Handlungen und Erlebnisse erst in sozialer Interaktion, wenn sie erzählt werden. Diese kleinen individuellen Geschichten sind Teil der größeren Geschichte der Gemeinschaft, sie werden von ihr geprägt.
Parg. 83. Das Wesen des einzelnen Menschen ist damit zu einem wichtigen Teil durch das geprägt, was er aus der Geschichte der Gemeinschaft geerbt hat. Es ist nicht möglich, diesen Besonderheiten der moralischen Identität zu entkommen - möglich ist höchstens, die eigene Sache unredlicherweise in die eines universellen Prinzips umzudeklarieren[52].
Parg. 84. Zur Verteilungsgerechtigkeit führt MacIntyre aus, dass es in der modernen pluralistischen Gesellschaft keine anerkannte Methode zur rationalen Gewichtung gibt. Z.B. der Supreme Court beschränkt sich darauf, die unterschiedlichen sozialen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Gerechtigkeitskonzeptionen lediglich durch Kompromissfindung zu befrieden, statt oberste Prinzipien zur Entscheidung heranzuziehen.
Parg. 85. Als einzig plausible Entscheidungsgrundlage in Verteilungskonflikten bietet sich MacIntyre der Verdienst des Einzelnen an. Dieser wird auch in realen Argumentationen normaler Menschen immer wieder herangezogen. Das Verdienst-Konzept braucht allerdings als Grundlage eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Konzeption des Guten, in der eine Konzeption des Guten die Wertmaßstäbe aller Gemeinschaftsmitglieder dominieren muss.
Parg. 86. Dem steht allerdings entgegen, dass ein derartiger moralischer Konsens in der modernen Gesellschaft nicht möglich ist. Wir leben mit einer Vielfalt und Vielzahl von bruchstückhaften Konzepten, die rivalisierende Gerechtigkeitskonzeptionen ausdrücken. Wenn in realen Argumentationen auf den Verdienst als Argument zurückgegriffen wird, dann geschieht das also aufbauend auf der Zugehörigkeit zu einer der rivalisierenden Parteien, und mit Gültigkeit nur innerhalb dieser Partei.
Parg. 87. Durch die Rivalität unterschiedlicher Gerechtigkeitskonzeptionen kann auch die moderne Politik nicht mehr auf moralischen Übereinstimmungen beruhen. Ganz im Gegenteil handelt es sich hier für MacIntyre um ,,Bürgerkrieg, der mit anderen Mitteln fortgesetzt wird“[53].
Parg. 88. Da die Regierung nicht die moralische Gemeinschaft der Bürger repräsentieren kann, ist der moderne Staat weder notwendig noch legitim. Auch widersprechen zentrale Eigenschaften der modernen Wirtschaftsordnung wie Individualismus, Habgier und die Hervorhebung von Marktwerten den traditionellen Tugenden.
Parg. 89. Für MacIntyre folgt daraus, dass alle modernen politischen Richtungen von seinem Standpunkt aus untragbar sind. Dies begründet er damit, dass seine Position der Tradition der Tugenden verpflichtet sei, während die moderne Politik in sich die Zurückweisung dieser Tugenden ausdrücke[54].
B. Komplexe Gleichheit: Michael Walzer
Parg. 90. Walzers Position unterscheidet sich von der oben skizzierten sehr weitgehend. Dies beginnt schon bei seiner Einordnung des kommunitaristischen Ansatzes: Für ihn geht es nicht um die Verteidigung vormoderner Tugenden gegen die Moderne, sondern um eine notwendige Korrektur der liberalen Gesellschaft, mit dem Ziel, sie und die in ihr enthaltenen Gemeinschaften zu stabilisieren.
Parg. 91. Die kommunitaristische Kritik ist demnach eine periodisch auftauchende Begleiterscheinung des Liberalismus -- lediglich die Ausgestaltung wechselt, je nachdem, ob die Einwände aus dem konservativen, dem marxistischen oder dem republikanischen Lager kommen. Die Kritik erscheint in zwei Spielarten: Die eine besagt, die liberale Theorie spiegele die Praxis liberaler Gesellschaften exakt wieder, die Liberalen schüfen eine asoziale Gemeinschaft geschichtsloser Individuen. Die andere Stoßrichtung konzentriert sich um den Vorwurf, die liberale Theorie verdrehe die Realität, sie verleugne die festen gemeinschaftlichen Bindungen eines jeden Menschen.
Parg. 92. Walzer selbst geht davon aus, dass beide Vorwürfe partiell zutreffen. Allerdings untergräbt der Liberalismus die bestehenden Gemeinschaftlichkeiten, zu denen auch die gemeinsame Wertschätzung der liberalen Grundrechte zu rechnen ist, immer wieder: Das Erreichte wird nicht als die endgültige liberale Gesellschaft akzeptiert, stets wird das Ideal einer noch freieren Gesellschaft postuliert. Hierdurch neigt der Einzelne dazu, immer wieder neue, höhere Ziele zu verfolgen, dieses ewige Voranschreiten bringt die Individuen stets aufs Neue in den Gegensatz zur Gemeinschaft.
Parg. 93. Den Kommunitarismus positioniert Walzer als Gegengewicht zu diesem Voranschreiten, das die im Liberalismus enthaltenen Gemeinschaftselemente und die bestehenden Gemeinschaften stärkt. Dafür muss der Staat zugunsten der Gemeinschaften Partei ergreifen, die den liberalen Werten am ehesten entsprechen. Diese Gruppen, z.B. Gewerkschaften oder kirchliche Wohlfahrtseinrichtungen, in denen Menschen zusammenarbeiten, um gemeinsam etwas zu meistern, sind zu stützen und zu fördern.
Parg. 94. Walzers Entwurf soll nicht abstrakt der Gerechtigkeit und Gleichheit nachspüren, sondern ein konkretes, realistisches Konzept einer gerechten und gleichen Gesellschaftsstruktur darstellen[55]. Er hat darum als Bezugspunkt eine politische Gemeinschaft, die durch ein gemeinsames Bewusstsein von Sprache, Geschichte und Kultur definiert wird. Dies kann ein Staat sein, möglicherweise werden Verteilungsentscheidungen aber auch eine kleinere Einheit innerhalb des Staates verlagert, um den verschiedenen, nebeneinander bestehenden Kulturen gerechtzuwerden[56].
Parg. 95. Wenn in dieser Gemeinschaft Verteilungsgerechtigkeit angestrebt wird, dann kann das nur eine menschliche Konstruktion sein, die je nach Kultur und Politik anders aussieht, denn: Wenn wirkliche Menschen nach Gerechtigkeit suchen, dann tun sie das nicht hinter einem ,,Schleier der Unwissenheit“, sondern vor einem kulturellen und geschichtlichen Hintergrund.
Parg. 96. Weiter wird üblicherweise versucht, einen einheitlichen Satz Verteilungskriterien zu konstruieren, der auf jede Verteilung anwendbar sein soll. Allerdings unterscheiden sich die Bereiche, in denen etwas verteilt wird, nach dem Verteilungsmedium, nach den Verteilenden und in der Praxis auch nach den Verteilungskriterien. Laut Walzer kann dies nicht anders sein, da sich diese Bedingungen nach dem Verständnis richten, das in der betroffenen Gemeinschaft über das jeweilige Gut vorherrscht -- es ist unausweichlich, dass die unterschiedlichen Güter historisch und kulturell bedingt unterschiedlich verstanden werden.
Parg. 97. Eine Theorie der Verteilungsgerechtigkeit muss weiter berücksichtigen, was Güter generell sind. Walzer macht die folgenden Annahmen:
1. Die einzelnen Objekte bekommen erst durch ihren gesellschaftlichen Kontext einen bestimmten Wert, sie werden dadurch zu sozialen Gütern. Daraus folgt, dass sie nicht isoliert bewertet werden können.
2. Menschen bilden ihre Identität durch Erwerb von und den Umgang mit derartigen sozialen Gütern, ohne eine Geschichte von Transaktionen mit anderen Menschen über soziale Güter wären sie nicht in einem erkennbaren Sinne menschlich.
3. Es gibt keine universellen Grundgüter, die Geschichte zeigt, dass Produktionsmittel, Land, Kapital etc. auch Nebenprodukte z.B. militärischer Macht oder religiöser Würden sein können.
4. Die soziale Bedeutung der Güter bestimmt ihre Verteilung, die Verteilung kann nur in Bezug auf diese Bedeutung gerecht sein.
5. Soziale Bedeutung und damit der Begriff der Gerechtigkeit ändern sich im Laufe der Zeit.
6. Güter mit unterschiedlicher Bedeutung sind unabhängig voneinander zu verteilen, z.B. sollte Geld nicht die Vergabe kirchlicher Ämter beeinflussen und auf dem Markt sollte der Glaube keine Rolle spielen.
Parg. 98. Die zuletzt geforderte Unabhängigkeit der unterschiedlichen Sphären sozialer Bedeutung ist selten gegeben. Meist dominiert ein Gut über viele andere Güter, mit diesem einen Gut können die Besitzenden dann die anderen Güter erwerben. Dieses dominante Gut wird dazu generell von einem oder von mehreren Menschen beherrscht, die die Dominanz aufrechterhalten und daraus Herrschaftsmacht über das gesamte Verteilungssystem ziehen.
Parg. 99. Die Forderung nach der Dominanz eines bestimmten, beherrschten Gutes wird als Ideologie präsentiert, so ist z.B. der allumfassende freie Warenverkehr die Ideologie derer, die über den beweglichen Reichtum herrschen. In Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen, die je eine Sphäre beherrschen, wird für die Überlegenheit der jeweils eigenen Ideologie gestritten.
Parg. 100. Wenn eine Gruppe über ein dominantes Gut herrscht, dann erzeugt die Ausnutzung dieser Herrschaft außerdem Widerstand. Die herrschende Ideologie wird von immer mehr Menschen in Frage gestellt, und schließlich werden Gegenforderungen postuliert. Diese Forderungen fallen zumeist in eine der folgenden drei Kategorien: Entweder wird das Ende der Herrschaft einer Gruppe über das dominante Gut gefordert, oder es wird ein Ende der Dominanz von einzelnen Gütern gefordert, oder es wird gefordert, dass ein neues, von einer anderen Gruppe beherrschtes Gut dominieren sollte.
Parg. 101. Für Walzer entspricht allein die Forderung nach dem Ende von Dominanz der Vielfalt und Komplexität von Verteilungsproblemen. Wenn es keine dominanten Güter mehr gibt, können sich Ungleichheiten nicht mehr multiplizieren. Trotz vieler kleiner Ungleichheiten in den einzelnen Sphären kommt es zu einem Zustand der Gleichheit zwischen den Sphären, den Walzer als ,,komplexe Gleichheit“ bezeichnet -- die Gleichheit herrscht nicht im Besitz eines dominanten Gutes, sondern in den Beziehungen der Menschen, vermittelt durch den Austausch sozialer Güter. Z.B. ballen sich Konflikte damit nicht mehr in der Sphäre eines dominanten Gutes, sondern werden innerhalb der Ursprungssphären im kleineren Maßstab ausgetragen.
Parg. 102. Aus dieser Kritik an der Dominanz von Gütern entsteht ein pluralistisches, offenes Verteilungskriterium:
Kein soziales Gut X soll an Menschen, die ein anderes Gut Y besitzen, nur aus dem Grunde verteilt werden, dass sie Y besitzen, ohne dass die Bedeutung von X bei dieser Verteilung berücksichtigt wird[57].
Parg. 103. Für das Projekt, die Verteilung nach diesen Grundsätzen umzugestalten, bietet die politische Gemeinschaft die richtige Umgebung. Nach der Beschreibung, die oben von dieser Gemeinschaft gegeben wurde, kommt es aufgrund von Sprache, Geschichte und Kultur zu sehr viel Übereinstimmung über die Bedeutung der Güter, so dass sich die Gemeinschaft dem Ideal einer Welt der gemeinsamen Bedeutungen so weit wie möglich annähert. Dazu kommt, dass diese Gemeinschaft ein besonders wichtiges Gut zu verteilen hat, nämlich die Mitgliedschaft in ihr selbst[58].
Parg. 104. In Bezug auf die Verteilung der Mitgliedschaft hat die jeweilige Gemeinschaft relativ große Wahlfreiheit. Diese Freiheit gehört zum Kern der Unabhängigkeit einer Gemeinschaft, sie erhält die oben genannten Gemeinsamkeiten. Allerdings gilt in der Sphäre des Gutes ,,Mitgliedschaft“ neben der politischen Entscheidung aller Bürger auch das allgemeine moralische Gebot der gegenseitigen Hilfe[59].
Parg. 105. Das generelle Prinzip der gegenseitigen Hilfe gebietet Beistand, wenn dieser von der einen Seite gebraucht wird und die andere Seite ihn mit relativ geringem Aufwand leisten kann[60]. Daraus folgt, dass Gemeinschaften, die großen Reichtum oder viel Platz haben, einen Teil dieses Überflusses den Benachteiligten zukommen lassen sollen, sei es durch Aufnahme in die Gemeinschaft oder durch Transfer von Vermögen oder Überlassen von Territorium.
Parg. 106. Auch für den Umgang mit Flüchtlingen hat dieses Prinzip Folgen: Sie sind aufzunehmen, soweit dies dem Zusammengehörigkeitsgefühl und den gemeinsamen Überzeugungen der Gemeinschaft keinen wirklichen Schaden zufügt. Dies bedeutet, dass Flüchtlinge, mit denen ein (ethnisches, politisches...) Zusammengehörigkeitsgefühl besteht, in größerem Umfang aufgenommen werden sollen.
Parg. 107. Der o.g. Umgang soll durch einen Asyl-Grundsatz gemildert werden. Nach diesem Grundsatz dürfen diejenigen, die sich bereits in der Gemeinschaft aufhalten, und die geltend machen können, aus religiösen oder politischen Gründen in ihrer Heimat verfolgt zu werden, nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Dies wird damit begründet, dass es einerseits höchst unmoralisch ist, gegen hilflose und verzweifelte Menschen Gewalt anzuwenden, um sie der Verfolgung auszuliefern. Andererseits führt die Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl Menschen dazu, dass die Gemeinschaft nicht mit allen Verfolgten dieser Welt überfordert wird[61].
Parg. 108. Aus einer Regelung der Einwanderung, die diesen Grundsätzen genügt, muss für Walzer eine gleiche Regelung der Einbürgerung folgen: Eine Gemeinschaft ist nur dann demokratisch, wenn alle ihre Mitglieder über das, was alle angeht, entscheiden können. Die Herrschaft eines exklusiven Kreises von Bürgern über die anderen, nicht derart privilegierten Bewohner des jeweiligen Territoriums ist demgegenüber eine Form der Tyrannei - die Verweigerung der vollen Mitgliedschaft ist stets nur der erste von vielen Missbräuchen[62].
Parg. 109. Im allgemeinen ist Walzers Forderung nach der Unabhängigkeit der verschiedenen Sphären der Gerechtigkeit sehr offen für verschiedene Gesellschaftsgestaltungen: Das Prinzip der komplexen Gleichheit macht noch weniger direkte Vorgaben für die Gesellschaftsform als Rawls' Theorie der Gerechtigkeit. Walzer entwirft allerdings ein Beispiel einer Gesellschaft, die seinen Vorstellungen nahe kommt und ihm für die USA angemessen erscheint: ein Wohlfahrtsstaat mit viel Bürgerbeteiligung, eingeschränktem Markt, freien Schulen, dem Schutz der Privatsphäre, viel politischer Freiheit und Mitwirkung und mit der Kontrolle der Arbeiter über die Betriebe. Diesen Ansatz bezeichnet er in Walzer (1983) als dezentralisierten demokratischen Sozialismus[63].
Parg. 110. In Walzer (1993) ist nicht mehr von Sozialismus die Rede - dieser Aufsatz bezieht sich stärker auf die Handlungsmöglichkeiten des existierenden Staates. Wieder geht es allerdings um die Stärkung der einzelnen Sphären: Der liberale Staat soll nicht länger neutral bleiben, sondern einzelne Gemeinschaften fördern, die in ihren Zielen den liberalen Idealen nahe kommen.
V. Feministische Kritik
Parg. 111. Die Debatte zwischen Liberalen und Kommunitariern hat ist von feministischer Seite in bedeutender Weise kritisiert worden. Im folgenden soll anhand der Darstellung bei Frazer und Lacey (1993) gezeigt werden, wie feministische Theorie mit beiden Fraktionen jeweils Teile der Position gemeinsam hat und andere Teile ablehnt, wobei an beiden Seiten die fehlende Auseinandersetzung mit Machtstrukturen kritisiert wird[64].
A. Die Position zum Liberalismus
Parg. 112. Frazer und Lacey erkennen an, dass der Liberalismus historisch vieles erreicht hat. Auch spielt er heute noch eine wichtige Rolle beim Schutz der formalen, verfahrensmäßigen Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit vom Staat.
Parg. 113. Damit ist das progressive Potential des Liberalismus allerdings erschöpft. Dies liegt vor allem an der o.g. praktisch fehlenden Auseinandersetzung mit Problemen der Machtverteilung und an dem sehr groben Gesellschaftsmodell, das sich auf den Gegensatz zwischen Staat und Bürger konzentriert: Z.B. die Rolle nicht-staatlicher Institutionen und nicht-staatlichen Verhaltens und überhaupt der gesellschaftliche Kontext werden so gut wie nicht berücksichtigt.
Parg. 114. In der Praxis zeigen sich drei Grundprobleme, die liberale Theorie als die Grundlage politischer Intervention aufwirft: Erstens können bestehende, offensichtliche Ungleichheiten teilweise im Rahmen liberaler Politik nicht beseitigt werden. Zweitens werden bestimmte Hierarchien, die sich auf die Geschlechterrollen stützen, nicht als Hierarchien erkannt. Drittens werden wichtige Aspekte der Sozialstruktur, die durchaus sozialen Wandel verursachen können, nicht beachtet, da der Liberalismus als rein politische Theorie angelegt ist[65].
Parg. 115. Hinter diesen Einzelproblemen steht die Unzulänglichkeit des liberalen Individualismus. Die Kritik von Frazer und Lacey (1993) arbeitet heraus, dass die Probleme hier vom Personenbegriff ausgehen, sich aber auch auf das liberale Verständnis von Freiheit und Rationalität, auf den Umgang mit Werten oder Macht und insbesondere auf die Trennung zwischen öffentlichem und privaten Sektor auswirken.
Parg. 116. In der liberalen Theorie wird das Selbst von seinem sozialen Umfeld und auch dem Körper distanziert. Damit können soziale Gegebenheiten und Beziehungen, also z.B. Klasse oder auch soziale Konstruktionen wie Rasse, Geschlechterrollen o.ä. nur sehr schwer berücksichtigt werden, obwohl sie wichtige Formen sozialer Ungleichheit erzeugen. Auch Faktoren wie Traditionen und Diskurse[66] werden nicht berücksichtigt, obwohl sie eine wichtige Rolle für Stabilität und Veränderung einer Gesellschaft spielen können.
Parg. 117. An Rawls Konstruktion eines ,,Schleiers der Unwissenheit“ wird in diesem Zusammenhang kritisiert, dass eine Auswahl nur stattfinden kann, wenn es Entscheidungskriterien gibt, diese stammen notwendigerweise aus einem sozialen Kontext. Im Falle des ,,Schleiers“ hat die eigentliche Entscheidung schon mit der Konzeption der Situation stattgefunden, eingeflossen ist der Standpunkt eines weißen, liberalen, der Mittelklasse zugehörenden US-Bürgers. Diese Prämissen werden durch Rawls' Konstruktion lediglich verschleiert, indem das Bild einer autonomen, ungebundenen Person konstruiert wird. Dieser Personenbegriff bringt den o.g. eingeschränkten Blickwinkel mit sich.
Parg. 118. Die obige Argumentation bezieht sich primär auf die Darstellung in Rawls (1975). An Rawls Reaktion auf die kommunitaristische Kritik[67] überzeugt nicht, dass nun zwar die Verwurzelung in einem sozialen Kontext, nämlich dem einer modernen demokratischen Gesellschaft, eingestanden wird. Rawls belegt aber nicht, dass die von ihm angeführten Werte tatsächlich aus einem in unserer Kultur bestehenden Grundkonsens über die Person stammen. Und ein solcher Konsens wäre notwendig, wenn Rawls' Theorie ihren Gültigkeitsanspruch nicht mehr auf die Objektivität und Neutralität stützen kann.
Parg. 119. Am liberalen Freiheitsbegriff wird kritisiert, dass dieser sich auf die Abwesenheit von staatlichen Einschränkungen des unabhängigen Selbst konzentriert. Nicht berücksichtigt wird dabei meist, dass auch positive Bedingungen für Selbstbestimmung erfüllt sein müssen. Und selbst wenn dies erkannt wird, beachtet die liberale Theorie die gesellschaftlichen Hierarchien, die Unfreiheit erzeugen, teilweise nicht. Insbesondere die Geschlechterrollen werden nicht berücksichtigt und führen zu unterschwelligen Unfreiheiten, die sich als fehlender Respekt anderer, fehlendes Selbstbewusstsein, Fehlen von Bildung oder von Geld manifestieren. Aus dieser Unfreiheit folgt auch politische Ungerechtigkeit.
Parg. 120. Gemäß dem liberalen Rationalitäts-Modell ist zwischen den irrationalen, vorgegebenen Zielen und der rationalen Auswahl der Mittel, um diese Ziele zu erreichen, zu unterscheiden. Wichtig für die Auswahl der Mittel sind allerdings auch die Werte, Beziehungen und Verantwortlichkeiten des Entscheidenden -- sie werden nach diesem Modell zu den nicht hinterfragbaren Zielen gezählt oder durch angebliche Objektivität und Unparteilichkeit verhüllt. Objektivität und Unparteilichkeit werden dabei durch die Position derer definiert, die die gesellschaftliche Macht haben. Wenn dagegen der Kontext aus Werten etc. ausdrücklich in die Entscheidung einbezogen wird, so dass er thematisiert werden kann, dann gilt das als Ausdruck eines typisch weiblichen Mangels an Rationalität und moralischer Vernunft.
Parg. 121. Auf den Themenkomplex, den Gemeinschaft, öffentliche Güter und Werte bilden, geht z.B. Rawls weder in seinem Grundwerk noch in seiner Reaktion auf die kommunitaristische Kritik näher ein. Er vernachlässigt die gesellschaftlichen Aufgaben, die keinen politischen oder ökonomischen Wert zugewiesen bekommen. Darin drückt sich wieder ein Grundproblem des liberalen Ansatzes aus, der einen gemeinschaftlichen Bereich und gemeinschaftliche Aufgaben nicht kennt. Historisch betrachtet sind die so ignorierten Aufgabenfelder meist Tätigkeiten der Frauen im sozialen Bereich gewesen, z.B. die Erziehung der Kinder.
Parg. 122. Das Thema Macht wird von der liberalen Theorie nur sehr begrenzt behandelt: Die Gegenwart von Macht in heutigen liberalen Gesellschaften wird von den liberalen Philosophen der Gegenwart übersehen, und die Kultur und soziale Sphären wie Familie, Sexualbeziehungen etc. werden bei der Theoriebildung ganz ausgeklammert. Diskriminierung nach Geschlechterrollen, ,,Rasse“-Konstruktionen etc. kann nicht angemessen berücksichtigt werden, da die gesellschaftlichen Machtstrukturen, die sich so manifestieren, in der liberalen Analyse keinen Platz haben. Dazu kommt, dass die Macht, die die liberale Analyse selbst hat, vollkommen übersehen wird.
Parg. 123. Zur liberalen Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre wird auf verschiedenen Ebenen Stellung bezogen: Einerseits ist die Abgrenzung in der Praxis unklar, da der Staat durch Familienrecht etc. immer auch in den klassischen privaten Sektor eingreift, so dass eine wirklich private Sphäre kaum noch existiert, und im öffentlichen Bereich auch Nichtregierungsorganisationen inzwischen großen Einfluss haben. Andererseits sind Eingriffe teilweise nicht klar von Nicht-Intervention abzugrenzen, und letztere ist ebenfalls eine Stellungnahme. Z.B. ist die Straffreiheit von Vergewaltigung in der Ehe einerseits eine Nicht-Intervention, die als solche eine bestimmte Wertung enthält, andererseits ist sie ein Ausdruck der staatlichen Regelung des Status der Ehefrau und der ehelichen Beziehungen.
Parg. 124. Dazu kommt, dass das Argument der Privatheit Unterdrückung auf dem Gebiet der Sexualität, des Familienlebens etc. aufrechterhält und unpolitisch erscheinen lässt. Dies geschieht, indem die Unterdrückung auf das Verhältnis der Betroffenen reduziert wird und die gesellschaftlichen Bedingungen ausgeblendet werden. Allerdings warnen Frazer und Lacey davor, als Folgerung daraus nun im privaten Bereich mehr Staatsaktivitäten zu fordern. Stattdessen kommt es darauf an, die Trennung zwischen Politischem und Privatem neu zu definieren und die politische Bedeutung bestimmter Bereiche des bisherigen privaten Sektors zu erkennen. Die Macht von ,,Institutionen im weiteren Sinne“, d.i. von Lobbies, Firmen, Banken, Gewerkschaften, der Kirche oder eben der Familie, muss auch in der politischen Theorie beachtet werden[68].
B. Stellungnahme zum Kommunitarismus
Parg. 125. Die feministische Theorie hat zum Kommunitarismus stärkere Verbindungen als zum Liberalismus - zumindest gilt dies für die Form des Feminismus, wie er von Frazer und Lacey (1993) vertreten wird. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass der Kommunitarismus einen großen Teil seiner Kritik am Liberalismus auf Argumente stützt, die der Marxismus und der kulturalistische Feminismus[69] entwickelt haben
1.
Gemeinsamkeiten
Parg. 126. Feminismus und Kommunitarismus teilen das Ziel der gemeinschaftsbezogenen Politik. In der kommunitaristischen Theorie ist die Gemeinschaft Grundlage der Überlegungen[70], und feministische Gruppen bemühen sich, lokal zu agieren, um hier und jetzt die Gemeinschaft zu verändern. Der Staat wird als potentiell unterdrückend und andererseits ineffektiv gesehen, versucht wird stattdessen, lokale Netzwerke aufzubauen, die sich flexibel den gemeinsamen Zielen widmen.
Parg. 127. Gemeinsam haben beide Theorien auch die Ablehnung des Individualismus. Dies wurde bereits ausführlich dargestellt[71].
Parg. 128. Die feministische Theorie enthält bestimmte kommunitaristische Ideale, z.B. das der Solidarität und das des gegenseitigen Austauschs. Beiden gemeinsam ist dazu die Anerkennung der Rolle von Werten, Bindungen etc. bei ethischen und rationalen Entscheidungen und die Berücksichtigung von öffentlichen Gütern in der Theoriebildung. Außerdem haben Kommunitarismus und Feminismus beide einen umfassenden Begriff der Person, der den Körper und Gemeinschaftseinflüsse in allerdings unterschiedlichem Ausmaß berücksichtigt.
Parg. 129. Weiter hebt der Kommunitarismus die vom Feminismus kritisierte Trennung zwischen öffentlichem und privatem auf oder relativiert sie zumindest, indem er einen generellen Gemeinschaftsbezug herstellt. Teilweise verwirklichen kommunitaristische Ansätze so den feministischen Slogan ,,Das Private ist politisch¡` Auch beschäftigen sich sowohl Kommunitaristen wie auch Feministinnen mit strukturellen Ungleichheiten im öffentlichen Bereich, die von liberaler Theorie nicht erfasst werden können, und weiter findet man auf beiden Seiten die Ablehnung des Objektivitätsanspruchs, den liberale Modelle erheben[72].
2.
Kritik
Parg. 130. Die feministische Kritik am Kommunitarismus setzt an verschiedenen Punkten an. Einerseits wird der konservative Charakter kommunitaristischer Gesellschaftsbilder bemängelt, andererseits werden Antworten auf wichtige Fragen vermisst. Dazu kommt, dass der kommunitaristische Gemeinschafts- und der Personenbegriff problematisch sind.
Parg. 131. Um ihre Kritik am konservativen Gehalt des Kommunitarismus zu entwickeln, stellen Frazer und Lacey zuerst dar, warum Konservativismus und Feminismus nicht vereinbar sind: Die konservative Theorie hat Elemente des Wirtschaftsliberalismus übernommen, diese kollidieren mit den staatlichen Eingriffen, die notwendig wären, um eine gleiche Teilnahme von Frauen in der wirtschaftlichen Sphären zu erreichen. Möglich ist nur die Separation der Frauen in eine eigene Sphäre, in der Ideale wie Mutterschaft, weibliche Tugendhaftigkeit etc. gelten. Das Anliegen feministischer Politik ist aber nicht eine derartige Idealisierung der hergebrachten weiblichen Rollenmodelle, sondern die Kritik der Geschlechterhierarchie.
Parg. 132. Der konservative Charakter des Kommunitarismus ist in bestimmten Richtungen, wie z.B. der um MacIntyre, ausdrücklich enthalten, dort wird die Unzufriedenheit mit der Moderne postuliert, vormoderne Gesellschaften werden idealisiert[73]. Die anderen Kommunitaristen benutzen Begriffe wie Gemeinschaft, Tradition oder Kultur, ohne sie näher auszufüllen. Dadurch behalten diese Worte weitgehend ihren hergebrachten Gehalt, dies ist im Effekt konservativ. Eine Ausnahme ist hier Walzer, der derartige Begriffe näher und anders ausfüllt[74].
Parg. 133. Dazu kommt der oft sehr weitgehende Relativismus kommunitaristischer Ansätze. Dies bedeutet, dass die Bewertung einer Gemeinschaft nur anhand der in ihr bestehenden Werte möglich ist, dadurch ist eine kritische Betrachtung praktisch nicht möglich. Anders wiederum Walzer, dessen Prinzip komplexer Gleichheit hier einen externen Bewertungsmaßstab darstellen kann. Dieses Prinzip hat allerdings keine kommunitaristische Begründung, rein kommunitaristisch gesehen ist keine interne Kritik z.B. am Patriarchat möglich.
Parg. 134. Weiter unterdrücken die von den Kommunitaristen postulierten Gemeinschaftsmodelle Frauen, z.B. die klassische Familie. Auch die gemeinschaftlichen Werte, die genannt werden, schließen teilweise Frauen von ihren Vorteilen aus oder beinhalten die Unterdrückung von Frauen.
Parg. 135. Generell wird von kommunitarischen Theoretikern zu wenig bedacht, wer die Werte, die gesetzt werden, erlangen kann. Außerdem wird kaum analysiert, welche Werte angenommen werden sollten.
Parg. 136. Alles in allem lässt sich der Kommunitarismus im allgemeinen schwer von sexistischem Konservativismus unterscheiden: Durch die fehlende Kritikfähigkeit gegenüber Werten, Gemeinschaftsformen etc. resultiert aus kommunitaristischer Theorie zumeist eine Untermauerung des Status quo in einer Gemeinschaft.
Parg. 137. Zu diesem Defizit kommt die fehlende Berücksichtigung wichtiger gemeinschaftsspezifischer Fragen. Zum Beispiel muss, um Ungleichheiten kritisieren zu können, über die Situation der Benachteiligten nachgedacht werden: Wie erhalten diese Zugang zu den Gemeinschaften, in denen sich die Macht konzentriert und in denen Werte bestimmt werden? Wie kann außerhalb der dominierenden Gemeinschaften irgendeine politische Macht erlangt werden?
Parg. 138. Das Fehlen eines angemessenen Erklärungsansatzes für Machtphänomene wirkt sich auch darin aus, dass die Machtbeziehungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften kaum berücksichtigt werden. Es wird nicht analysiert, welche Bedeutung die Werte erlangen können, die in nicht mächtigen Gemeinschaften geprägt werden, wie ein politischer Einfluss schwächerer Gemeinschaften möglich sein könnte.
Parg. 139. Aus dieser Diagnose ziehen Frazer und Lacey (1993) den Schluss, dass sich die Kommunitaristen trotz ihres Schwerpunktes auf der Gemeinschaftsidee nicht genügend mit den Problemen, die Gemeinschaften mit sich bringen, beschäftigen.
Parg. 140. Weitere Probleme bringen der kommunitaristische Personen- und Gesellschaftsbegriff mit sich: Die Person wird als das Produkt einer Gemeinschaft gesehen. Damit wird der einzelne leicht das Opfer der gemeinschaftlichen Zustände, da er sich nicht von der Gemeinschaft distanzieren kann: Wenn die Sozialisation alles ist, wie insbesondere bei MacIntyre deutlich wird, dann kann die Sozialisation nicht kritisiert werden. Und falls doch Kritik entsteht, kann diese nicht vermittelt werden, da der einzige gemeinsame Bezugspunkt die kritisierte Gesellschaftsstruktur ist.
Parg. 141. In einer pluralistischen Gesellschaft ergibt sich aus diesem Ansatz, dass Personen, die zu mehreren Gemeinschaften gehören, in ihren Werten stark fragmentiert sind. Das Nebeneinander von mehreren Wertordnungen in einer Person erzeugt allerdings keine internen Konflikte, die zu Kritikfähigkeit des einzelnen führen könnten: Die Persönlichkeit gliedert sich ebenfalls, entsprechend den verschiedenen Wertordnungen, in verschiedene Teile.
Parg. 142. Um die einheitliche Person vor dem Zerfall zu bewahren, konstruieren Theorien wie die von MacIntyre eine idealisierte vormoderne Welt. Sandel reagiert dagegen, indem er das Selbst als in einem gewissen Maße unabhängig und reflektierend über die Gesellschaft und die eigene Identität konzipiert. Damit kommt er in die Nähe liberaler Vorstellungen vom autonomen Selbst. Taylor nähert sich in seiner Reaktion ebenfalls liberalen Ansätzen, da er eine allgemeine menschliche Grundeigenschaft einführt, die Suche nach einem Sinn im eigenen Leben.
Parg. 143. Ein weiteres Manko des kommunitaristischen Ansatzes ist, dass das Geschlecht sehr selten als relevante Kategorie auftaucht. Walzer gehört zu den wenigen, die das Thema ansprechen, allerdings nur unter dem Oberbegriff Liebe und Verwandtschaft, also in der Privatsphäre[75]. Eine systematische Einbeziehung von Geschlechterfragen fehlt, genau wie der Liberalismus beachtet auch der Kommunitarismus nicht den Einfluss der Geschlechterrollen auf gesellschaftliche Strukturen[76].
VI. Perspektive
Parg. 144. Keine der hier untersuchten sozialphilosophischen Grundpositionen bietet den einen überzeugenden Ansatz, der die Probleme heutiger vielfältiger Gesellschaften lösen könnte.
Parg. 145. Der Liberalismus bemüht sich darum, den Mitgliedern der verschiedenen Gemeinschaften einen gemeinsamen gesellschaftlichen Rahmen zu bieten, der von gleichen Rechten und Freiheiten geprägt sein soll. Aufgrund seines individualistischen Menschenbildes kann er allerdings dabei den Gemeinschaften nicht gerecht werden -- die gemeinschaftsinternen sozialen und kulturellen Ungleichheiten können nicht berücksichtigt werden und pflanzen sich bis auf die Gesellschaftsebene fort, andererseits wird der Zusammenhalt der Gemeinschaften erschüttert.
Parg. 146. Auch ist der objektive Standpunkt, den die liberale Rationalität einnehmen soll, zumindest fraglich. Damit werden auch die meisten Begründungsansätze der liberalen Moraltheorie instabil.
Parg. 147. Kommunitaristische Entwürfe haben allerdings nicht unbedingt bessere Lösungen. Die konservative Richtung setzt offen auf die althergebrachten, autoritären Modelle oder drückt schlicht ihre Unzufriedenheit mit der Moderne aus, und auch kommunitaristische Entwürfe, die nicht in diese Sackgasse geraten, lösen keineswegs alle Probleme:
Parg. 148. Zwar wird von dieser Fraktion nicht nur der Stellenwert von Gemeinschaft erkannt, Walzer z.B. zeigt auch ein Kriterium auf, nach dem die Strukturen einer Gemeinschaft beurteilt werden können. Auch entwirft er das Bild einer pluralistischen Gesellschaft, in der die gemeinschaftlichen Sphären nach seinem Grundsatz komplexer Gleichheit unabhängig sein können und hebt sich damit vom Mainstream der kommunitaristischen Theorie ab.
Parg. 149. Allerdings berücksichtigt auch sein Ansatz die Situation der Benachteiligten zu wenig -- z.B. wird nicht analysiert, wie der Zugang zu einzelnen Sphären erreicht werden kann, auch die Machtbeziehungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften werden kaum berücksichtigt.
Parg. 150. Dazu kommt, dass die konkrete Bedeutung des Prinzips komplexer Gleichheit kaum greifbar ist, die Herleitung von Walzers Gesellschaftsentwurf aus dem Prinzip ist alles andere als zwingend: Erkennen kann man dies auch daran, dass allein nach Walzers Auffassung schon zwei derart gegensätzliche Gesellschaftsmodelle wie das sozialistische und das liberale mit dem Grundsatz vereinbar sind.
Parg. 151. Festzuhalten bleiben aber die Anforderungen an eine sozialphilosophische Theorie der gerechten Gesellschaft, die sich in der Darstellung herauskristallisiert haben:
Parg. 152. Einerseits muss der Schutz der negativen und auch der positiven Freiheit des Individuums beachtet werden. Andererseits sind vielfältige Gemeinschaften zu fördern, und mit ihnen auch Gemeinschaftswerte wie z.B. die Solidarität. Dazu kommt notwendigerweise die Analyse und Kritik gesellschaftlicher Machtstrukturen.
Parg. 153. Wie sich diese Erfordernisse miteinander vereinen lassen, bleibt allerdings unklar. Unbeantwortet ist auch die Frage, wie sich eine derartige Theorie umsetzen ließe.
Literatur
Frazer, Elizabeth und Lacey, Nicola.
The Politics of Community.
Hemel Hempstead, 1993.
Friedman, Milton.
Kapitalismus und Freiheit.
Stuttgart, 1971.
Girvetz, Harry K.
The Evolution of Liberalism.
London, zweite Aufl., 1969.
Girvetz, Harry K.
Liberalism.
In: Encyclopaedia Britannica -- Macropaedia. Chicago, 1977.
Honneth, Axel.
Einleitung.
In: Axel Honneth (Hg.), Kommunitarismus -- eine Debatte über die moralischen
Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt a.M., 1993.
Kukathas, Chandran und Pettit, Philip.
Rawls -- a Theory of Justice and its Critics.
Cambridge, 1990.
Locke, John.
Zwei Abhandlungen über die
Regierung.
Frankfurt a.M., 1967.
MacIntyre, Alasdair.
Justice as a Virtue.
In: Shlomo Avineri und Avner de Shalit (Hg.), Individualism and Communitarianism.
Oxford, 1992.
MacIntyre, Alasdair.
Ist Patriotismus eine Tugend?
In: Axel Honneth (Hg.), Kommunitarismus -- eine Debatte über die moralischen
Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt a.M., 1993.
MacIntyre, Alasdair.
The Concept of a Tradition.
In: Markate Daly (Hg.), Communitarianism -- A New Public Ethics. Belmont,
Cal., 1994.
Nozick, Robert.
Anarchy, State, and Utopia.
New York, 1974.
Okin, Susan Moller.
Whose Traditions? Which Understandings?
In: Markate Daly (Hg.), Communitarianism -- A New Public Ethics. Belmont,
Cal., 1994.
Rawls, John.
A Theory of Justice.
Oxford, 1971.
Rawls, John.
Eine Theorie der Gerechtigkeit.
Frankfurt a.M., 1975.
Rawls, John.
Gerechtigkeit als Fairneß:
politisch und nicht metaphysisch.
In: Axel Honneth (Hg.), Kommunitarismus -- eine Debatte über die moralischen
Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt a.M., 1993.
Sandel, Michael.
Die verfahrensrechtliche Republik
und das ungebundene Selbst.
In: Axel Honneth (Hg.), Kommunitarismus -- eine Debatte über die moralischen
Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt a.M., 1993.
Sandel, Michael.
Justice and the Moral Subject.
In: Markate Daly (Hg.), Communitarianism -- A New Public Ethics. Belmont,
Cal., 1994.
Walzer, Michael.
Spheres of Justice.
Oxford, 1983.
Walzer, Michael.
Die kommunitaristische Kritik am
Liberalismus.
In: Axel Honneth (Hg.), Kommunitarismus -- eine Debatte über die moralischen
Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt a.M., 1993.
Atıf önerisi: Yazar Adı ve
Soyadı, e-akademi, Sayı, Tarih, Paragraf Numarası, İnternet
Adresi (http://www.e-akademi.org/makaleler/below1.html)
* Diplom Jurist, promoviert an der Universität Bielefeld.
[1] So z.B. Girvetz (1969), S. 23
[2] In der dt. Übersetzung: Locke (1967)
[3] Locke (1967), § 95.
[4] Nach Girvetz (1977).
[5] So H. Spencer laut Girvetz (1977).
[6] Gem. Girvetz (1977).
[7] Sein Hauptwerk: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, Berlin 1974, engl. Original London 1936.
[8] Darstellung insgesamt nach Girvetz (1977).
[9] Friedman (1971), S. 24 f. Die am. Originalausgabe dieses Buches erschien 1962.
[10] Deutsche Übersetzung: Rawls (1975).
[11] Nach Kukathas und Pettit (1990), S. 2 ff. – auch die Grundstruktur der folgenden Zusammenfassung lehnt sich dort an.
[12] Rawls (1975), S. 19.
[13] Rawls (1975), S. 29.
[14] Rawls bezeichnet die Konzeption in ihrer Anwendung auf die Gesetze als Gesetzesherrschaft, z.B. Rawls (1975), S. 80.
[15] Rawls (1975), S. 144 ff.
[16] Rawls (1975), S. 177 ff.
[17] Zitiert nach Rawls (1993).
[18] Übersetzung von Rawls (1971), S. 303. In der dt. Ausgabe wird diese sog. Generelle Konzeption an der entspr. Stelle nicht mehr genannt.
[19] Rawls (1975), S. 180 f.
[20] Ebd., S. 202 ff.
[21] Ebd., S. 175 f.
[22] Ebd., S. 224 ff.
[23] Rawls (1975), S. 223.
[24] Rawls (1975), S. 242.
[25] Ebd., S. 241f .
[26] Ebd.
[27] Ebd., S. 234 ff. und 242 ff.
[28] Ebd., S. 251 ff.
[29] Ebd., S. 291.
[30] Dazu: Rawls (1975), S. 87 ff. Kurz gesagt ist die Pareto-Optimalität gegeben, wenn sich ein Zustand nicht so abändern lässt, dass mindestens ein Mensch besser dasteht, ohne dass irgend jemand schlechter dasteht.
[31] Rawls (1975), S. 309.
[32] Ebd., S. 310.
[33] Ebd.
[34] Ebd., S. 312 ff.
[35] So z.B. Nozick (1974), S. 149 ff., bes. S. 198, zum zweiten Einwand: S. 163.
[36] So Honneth (1993).
[37] Nach Sandel (1993).
[38] Zitiert nach Rawls (1993), S. 41.
[39] Sandel (1993).
[40] In Sandel (1994).
[41] So Rawls (1975), S. 446 f.
[42] Nach Rawls (1993).
[43] Nach Rawls (1975), S. 572 f.
[44] Nach Rawls (1993).
[45] So auch Okin (1994). Gleichheit ist auch das durchgängige Thema in Walzer (1983).
[46] Nach Frazer und Lacey (1993), S. 106 f.
[47] Z.B. in MacIntyre (1993), S. 93.
[48] MacIntyre (1993), S. 92 f.
[49] Im engl. Text: „quest“.
[50] Nach MacIntyre (1994), S. 123 ff.
[51] MacIntyre (1993), S. 92 f.
[52] MacIntyre (1994).
[53] Übersetzung nach MacIntyre (1992).
[54] Insgesamt nach MacIntyre (1992).
[55] Walzer (1982), S. xiv.
[56] Ebd., S. 28 ff.
[57] Übersetzung nach Walzer (1983), S. 20. Darstellung insgesamt nach: Ebd., S. 3 ff.
[58] Ebd., S. 28 f.
[59] Ebd., S. 61 ff.
[60] Ebd., S. 33.
[61] Ebd., S. 45 ff.
[62] Ebd., S. 62 f.
[63] Ebd., S. 318.
[64] Frazer und Lacey (1993), S. 31 f.
[65] Frazer und Lacey (1993), S. 78 ff.
[66] Hier im Sinne von Theorien, die die Realität ihrer Anhänger bestimmen.
[67] Siehe oben III., B. ff.
[68] Darstellung nach Frazer und Lacey (1993), S. 53 ff.
[69] Eine Richtung, die die Unterdrückung der Frau als in der Gesellschaft und ihren Praktiken und Diskursen institutionalisiert ansieht. Nach eigener Einschätzung stehen z.B. Frazer und Lacey dieser Schule nahe, sind aber auch stark vom sozialistischen Feminismus geprägt, ebd. S. 107.
[70] Siehe z.B. die Darstellung von MacIntyre’s Ansatz, oben IV., A. ff.
[71] Siehe Sandel’s kommunitaristische und Frazer unsd Lacey’s feministische Kritik am Liberalismus oben Teil III., A. f, bzw. V., A. f.
[72] Darstellung nach Frazer und Lacey (1993), S. 117 ff.
[73] Siehe oben IV. A. ff.
[74] Siehe oben IV. B. ff.
[75] In Walzer (1983), S. 239-243.
[76] Darstellung nach Frazer und Lacey (1993), S. 130 ff.